Die Verlegerin entführt uns in die goldene Ära des investigativen Journalismus - und ist damit so etwas wie ein Prequel zu Die Unbestechlichen.
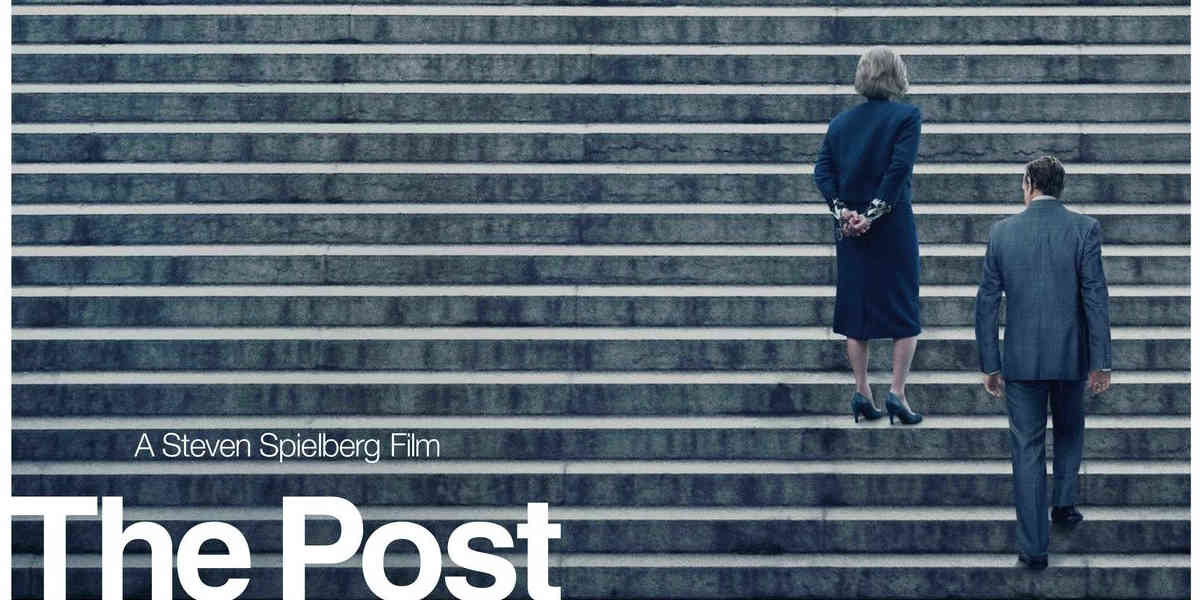
Die Verlegerin entführt uns in die goldene Ära des investigativen Journalismus – und ist damit so etwas wie ein Prequel zu Die Unbestechlichen.
Er ist der Guido Knopp Hollywoods. Wie kein Zweiter versteht es Regisseur Steven Spielberg, historische Stoffe zu dichter Spielfilm-Unterhaltung zu verweben. Die Verlegerin (im Original The Post) heißt seine neueste Fingerübung und bietet alles, was man von einer Spielberg’schen Geschichtsstunde erwarten darf: Packendes Drama, tolle Schauspielleistungen und etwas Wissen, das hängen bleibt. Diesmal nimmt sich der Filmemacher eine publizistische Sternstunde vor: die Veröffentlichung der so genannten Pentagon Papers durch amerikanische Zeitungen im Jahre 1971. Ihre Enthüllungen entlarvten die militärischen Verwicklungen der USA in Südostasien als eine Aneinanderreihung von Fehleinschätzungen und Machtmissbräuchen, gleichzeitig markierten sie den Aufbruch in eine goldene Ära des investigativen Journalismus. Eigentlich das perfekte Setting für einen Journalistenfilm. Das Problem: Als oscar-nominiertes „Prequel“ (Andreas Busche, tagesspiegel) zu Alan J. Pakulas Die Unbestechlichen vermag Die Verlegerin dem Genre kaum etwas Neues hinzuzufügen.
Text: Patrick Torma. Bildmaterial: Universal Pictures Germany.
Katharine Graham übernimmt die Post
Katharine „Kay“ Graham (Meryl Streep) hat es nicht leicht. Nach dem Freitod ihres depressiven Mannes Philip – ihr Umfeld, das sich aus ehemaligen Weggefährten ihres Gatten rekrutiert, bezeichnet dessen Ableben euphemistisch-pietätvoll als „den Unfall“ – übernimmt sie die Leitung der Washington Post Company. Ihrem Dasein als High Society Lady entrissen, füllt sie plötzlich eine Rolle aus, die in ihren Augen nie für sie vorgesehen war – nicht zuletzt, weil die Männerdomäne, die sie umgibt, ihr genau das glauben machen will: in die Rolle der Verlegerin, die das traditionsreiche Blatt in die Zukunft führen soll.
Trotz erheblicher Selbstzweifel und dank der Schützenhilfe des ihr wohlgesonnenen Verwaltungsratvorsitzenden Fritz Beebe (Tracy Letts) gelingt es ihr 1971, den lange geplanten Börsengang der Washington Post einzutüten. Wäre da nicht dieser Passus, der ihr Sorgen bereitet. Dieser gestattet es den Banken, binnen einer Woche nach Vertragsunterschrift aus dem Deal auszusteigen, sollten „schwerwiegende Ereignisse katastrophalen Ausmaßes“ eintreten, die die Rentabilität des Unternehmens beschädigen. Just schlittert die Zeitung in eine publizistische Zerreißprobe.
 Die Kinnlade klappt runter: Die Redakteure der Washington Post müssen feststellen, dass man ihr eine heiße Story aus dem eigenen Vorgarten entrissen hat.[/caption]
Die Kinnlade klappt runter: Die Redakteure der Washington Post müssen feststellen, dass man ihr eine heiße Story aus dem eigenen Vorgarten entrissen hat.[/caption]
Die Times und die Pentagon Papers
Gerade erst hat die Konkurrenz von der New York Times erste Auszüge eines geheimen Dossiers des US-Verteidigungsministeriums veröffentlicht. Diese Papiere, die als Pentagon Papers in die Geschichte eingehen werden, zeugen nicht nur davon, dass die US-Regierung den militärischen Sieg in Vietnam längst abgeschrieben hat. Sie belegen auch, dass sämtliche US-Präsidenten seit 1950, angefangen von Harry S. Truman über John F. Kennedy bis hin zum jetzigen Amtsinhaber Richard Nixon, die amerikanische Öffentlichkeit zum Narren gehalten haben, was die Verstrickungen in Südostasien betrifft.
<p>Die <em>Pentagon Papers widerlegen das Bild von der Beschützermacht, die sich zur Wahrung freiheitlicher, demokratischer Werte in einen kriegerischen Konflikt hineinziehen ließ und entlarven eine Außenpolitik, die von Einmischungen, Fehleinschätzungen und dem Zünden von Nebelkerzen geprägt ist. Wer so drauf ist, der schreckt ganz sicher nicht zurück, die amerikanische Presse einzuschüchtern: Mit der Begründung, die Zeitung gefährde den Erfolg der militärischen Intervention in Vietnam, lässt Washington weitere Veröffentlichungen der New York Times richterlich verbieten bzw. aussetzen, bis ein endgültiges (Eil-)Urteil des Obersten Gerichtshofs gefällt ist.

Rabauke vom Dienst: Ben Bradlee (Tom Hanks) ist ein sympathisch-polternder Chefredakteur. Die Redaktion der Washington Post steht stramm.
Redaktion “droht” mit Veröffentlichung
Das erzwungene „Moratorium“ ruft Ben Bradlee (Tom Hanks) auf den Plan. Für den Chefredakteur der Washington Post kommt der Scoop der Konkurrenz einer Schmach gleich – für ihn fühlt es sich an, als habe die New York Times diesen Schatz in seinem eigenen „Vorgarten“ gehoben. Nun wittert er die Chance, die Nachrichtenhoheit zu erlangen. Über seinen Mitarbeiter Ben Bagdikian (schauspielerisches Highlight neben den Hauptdarstellern Streep & Hanks: Bob Odenkirk, bekannt als schmieriger Anwalt Saul Goodman aus Breaking Bad und Better Call Saul) gelangt seine Redaktion in den Besitz dieses Berichts – und „droht“ mit Berichterstattung. Zunächst ohne Rücksicht auf mögliche Folgen für den Börsendeal seiner Zeitung.
Dabei sieht das Worst Case-Szenario eine Unterlassungsklage vor, gefolgt von einer strafrechtlichen Anklage wegen Geheimnis- und Landesverrats. Was aus Anlegersicht ganz eindeutig unter den Sammelbegriff „schwerwiegende Ereignisse katastrophalen Ausmaßes“ fallen dürfte. Plötzlich schwebt die Veröffentlichung der Pentagon Papiere wie ein Damoklesschwert über der Existenz seiner Chefin, Katharine Graham, und damit indirekt über den Köpfen der eigenen Belegschaft. Dazu muss man wissen, dass Zeitungen schon zu Beginn der 1970er-Jahre keine attraktiven Cash Cows mehr sind. Das Fernsehen setzt den Printerzeugnissen zu. Ohne neues Kapital fehlen der Washington Post, die zwar über reichlich Tradition, aber noch nicht über genügend nationales Renommee verfügt, die Mittel, um am Markt zu bestehen.
[caption id="attachment_1626" align="aligncenter" width="628"] Die Verlegerin und der US-Verteidigungsminister außer Dienst: Nach dem Tod ihres Mannes stand Robert McNamara Katharine Graham (Meryl Streep) zur Seite. Das wird nun zum Problem.
Die Verlegerin und der US-Verteidigungsminister außer Dienst: Nach dem Tod ihres Mannes stand Robert McNamara Katharine Graham (Meryl Streep) zur Seite. Das wird nun zum Problem.Fortsetzung der Spotlight-Festspiele
Als wäre das nicht schon Zwickmühle genug, verstrickt sich Katharine Graham in ihrer eigenen Befangenheit. Auf der einen Seite fühlt sie sich dem Erbe ihrer Familie verbunden. Auf der anderen Seite steht jedoch die Freundschaft zu einem gewissen Robert McNamara, der ihr nach dem Tode ihres Mannes zur Seite stand. Jener Robert McNamara, der unter John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson als US-Verteidigungsminister tätig war und in dieser Funktion die Anfertigung der Pentagon Papiere für die Nachwelt anordnete.
Haarklein zeichnet <em>Die Verlegerin die Konfliktlinien des Sommers im Jahre 1971 nach, um sie im Schlussspurt dieses zweistündigen Journalistendramas vergleichsweise wundersam aufzulösen. Am Ende steht genau das kraftvolle Plädoyer zugunsten einer intakten und standhaften vierten Gewalt, das alle im Vorfeld erwartet haben und das die internationale Kritik als Fortsetzung der Spotlight-Festspiele hochleben lässt. 2016 räumte Tom McCarthys Film, der die Geschichte einer aufopferungsvollen Recherche und der Enthüllung eines flächendeckenden Kindesmissbrauchs innerhalb der Katholischen Kirche erzählt, überraschend den Oscar in der Kategorie Best Picture ab. Tosender Applaus für einen viel gescholtenen Berufsstand, Gelegenheit für den einen oder anderen Klopfer auf die eigene Schulter. Jetzt, inmitten der Oscar-Saison 2018, branden die Lobeshymnen wieder auf. Die Sehnsucht nach journalistischen Best Practices ist ungebrochen groß. Verständlich: Die Welt hat sich nicht unbedingt zum Besseren gewendet.

Der Fund, der die US-Presselandschaft verändert: Ben Bagdikian (Bob Odenkirk) gerät in den Besitz der Pentagon Papers. Die Washington Post steht vor einer publizistischen Zerreißprobe.
Der liberale Fingerzeig an Trump
Anstatt von einem mürbe gewordenen Heilsbringer werden die USA inzwischen von einem konservativen Giftzwerg regiert. Vordergründig nimmt Die Verlegerin die Präsidenten der Vergangenheit in die Mangel. Der Fingerzeig jedoch richtet sich an den Präsidenten der Gegenwart, der seine Fake News derart unverfroren in die Welt zwitschert, dass „Tricky Dick“ Nixon aus der Ferne betrachtet wie ein scharfsinniger Diplomat daherkommt. Zwischen den Zeilen liegt die Warnung vor der Geschichte, die sich wiederholt. Oder treffender: die Sehnsucht nach einer Wiederholung. Anlass zur Hoffnung, dass irgendwer die ganz großen Schweinereien dieses Mannes ausbuddelt, den gibt es. Schon lange nicht mehr waren die Augen der US-Presse so penibel auf das Weiße Haus gerichtet wie unter Trump.
Die Verlegerin beschwört den journalistischen Eifer, den es hierfür benötigt – und reist in eine Ära zurück, in der sich die Lage der großen Nation noch desolater darstellte als heute. Vietnam, Pentagon Papers und Watergate stehen synonym für die Erschütterung der amerikanischen Demokratie. Eine Welle von Beben rüttelt ein Volk wach. Was mit der Bürgerrechtsbewegung und den 68ern beginnt, mündet in totaler Desillusionierung. Wer es vorher nicht wahrhaben wollte, dem wird spätestens zu Beginn der 1970er-Jahre vor Augen geführt, dass jene Männer, die die moralische Überlegenheit einer freiheitlichen Weltanschauung predigten, diese Werte in Wahrheit systematisch ausgehöhlt hatten. Der amerikanische Traum wird zum Trauma.

Die Vorhut für Die Unbestechlichen – Die Verlegerin erzählt die Vorgeschichte zu Alan J. Pakulas filmischer Journalistenfibel von 1976.
Das “Prequel” zu Die Unbestechlichen
Gleichzeitig stehen Vietnam, Pentagon Papers und Watergate für die Emanzipation der Presse. Hatte sie sich zuvor nur allzu gern auf die Verlautbarungen der Mächtigen verlassen und sich im Blitzlichtgewitter ihrer Galaempfänge gesonnt, besinnt sie sich fortan auf ihre eigentlichen Aufgaben. Im Film ist die Washington Post anfangs nicht mehr als ein Hauptstadt-Blatt, das sich um die Presseakkreditierung für die Hochzeit der Präsidententochter sorgt. Man hält was auf sich; ist aber ohne nationale Relevanz. Erst durch die Ereignisse um die Pentagon Papers stößt die Zeitung in die Spitze des amerikanischen Printwesens vor.
Was wiederum das Selbst- und Sendungsbewusstsein der Post-Redakteure beflügelt. Er ist natürlich spekulativ – der Gedanke, dass Ben Bradlee ohne diesen Vorstoß vielleicht gar nicht den Mut aufgebracht hätte, zwei Grünschnäbel wie Bob Woodward und Carl Bernstein auf Richard Nixon loszulassen. Ganz abwegig ist er allerdings nicht. Im Gegenteil: Die Verlegerin drängt ihn geradezu auf. Der Film schließt mit dem Blick auf die dunkle Fassade des Watergate-Komplexes; von außen sieht man die Lichtkegel aus den Taschenlampen der präsidialen Einbrechervorhut aufblitzen. Es ist die Auftaktszene von Alan J. Pakulas filmischer Journalistenfibel – Die Unbestechlichen. Ein Kniff, der Andreas Busche vom <em>tagesspiegel zu seinem schönen Vergleich mit den Post Credit-Cliffhangern im Marvel-Universum verleitet: Die Verlegerin sei „eigentlich ein Prequel“.

Eine Frau unter Männern: Die Verlegerin ist auch ein Film über Emanzipation. Nach anfänglicher Unsicherheit lässt sich “Kay” Graham nicht mehr von den Herren der Schöpfung belatschern: “Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und gehe jetzt ins Bett.”
Die Verlegerin ist wenig eigenständig
Mit Prequels ist es aber so eine Sache. Selbst wenn sie gut sind, den Geist des Originals atmen und die richtige Dosis Fan-Service bieten, so vermögen sie der Ursprungserzählung oft wenig substanzielles hinzuzufügen. So ergeht es auch Die Verlegerin als Journalistenfilm. Das Setting ist perfekt, weil er uns in DAS goldene Zeitalter des investigativen Journalismus entführt. Gleichzeitig ist dieses Setting hoffnungslos veraltet. Zweifellos sind die Themen (der Umgang mit Whistleblowern, das Nebeneinander von beruflichen und persönlichen Kontakten, die Notwendigkeit wasserdichter Recherchen), die der Film verhandelt, nach wie vor aktuell. Und auch die biographische Würdigung der beiden Hauptfiguren, allen voran die der Katharine Graham*, rechtfertigt einen Journalistenfilm wie diesen. Insbesondere dann, wenn er so stilsicher inszeniert ist wie Die Verlegerin.
* Lesetipp am Rande: Wer wissen will, warum Die Unbestechlichen-Hauptdarsteller und -Produzent Robert Redford die Rolle der Katharine Graham unterschlug, dem sei die Filmkritik von Dobrila Kontić im Fachjournalist empfohlen.
Aber: Abgesehen von der biographisch-feministischen Perspektive und dem Trump-Kontext bietet Die Verlegerin nichts, was andere – und vor allem viel frühere – Journalistenfilme vor ihr nicht schon geboten hätten. Abstrahiert man die wahre Begebenheit, die Pentagon-Papiere und die realen Personen, dann tun sich beispielsweise erstaunliche Parallelen zu einem Humphrey Bogart-Klassiker auf.

Die Verlegerin von 1952? In Die Maske runter (OT: Deadline USA) finden sich erstaunlich viele Parallelen zu Spielbergs neuester Fingerübung. Und ist fast noch moderner.
Die Maske runter: Vorbild für Die Verlegerin?
In Die Maske runter (OT: Deadline USA) von 1952 (!) bastelt der auf Krawall gebürstete Chefredakteur der fiktiven Zeitung Day, George Burrows (Bogart), an einer exklusiven Story. Diese Enthüllung kann einen besonders mächtigen Mann zu Fall bringen – oder aber der gesamten Redaktion den Job kosten. Mindestens. So oder so: die Geschichte liegen zu lassen, ist keine Option (um es mit den Worten von Tom Hanks alias Ben Bradlee aus Die Verlegerin zu sagen: „Nur Veröffentlichung schützt Veröffentlichung.“). Burrows weiß, diese Geschichte ist der letzte Schuss, um den unersetzbaren Wert seiner Zeitung zu demonstrieren. Merke: auch in den 1950er-Jahren war das Printwesen kein Zuckerschlecken. Denn parallel steht die Day vor einem Verkauf an die Konkurrenz. Beeindruckt von dem Mut ihres Chefredakteurs entschließt sich die Verlegerin (!!) Margaret Garrison gegen eine Veräußerung, um das Erbe ihres Mannes (!!!) nicht zu zerschlagen.
Nicht nur die inhaltlichen Ähnlichkeiten sind frappierend. Beide Filme zelebrieren die Zeitungsproduktion: Schreibmaschinen klackern, Zeitung wird in Blei gegossen, Druckerpressen setzen sich behäbig in Bewegung und sind mit einem Mal nicht mehr aufzuhalten (das stärkste Bild in Die Verlegerin: die rotierenden Maschinen, deren Grollen bis in die obersten Etagen des Gebäudes zu spüren ist und symbolisch für die Erschütterung der Macht steht). Der Unterschied: In Die Maske runter sind Bleisatz und Rohrpost authentischer Teil des Ganzen. In Die Verlegerin sind sie nur nostalgische Staffage. Die Ironie: Mit der bitteren Schlusspointe in Nacken – die ich an dieser Stelle nicht verraten will, Besprechung folgt – wirkt Die Maske runter im Vergleich zu Die Verlegerin geradezu modern.

Publizistische und ökonomische Interessen sind Ying-und-Yang-mäßig in Einklang gebracht. Zumindest für den Moment: Ben Bradlee und Katharine Graham.
Endstation Sehnsucht: Die Verklärerin
Die Verlegerin ist ein sehnsüchtiger, rückwärts gewandter, bisweilen sogar verklärender Film. Weil er einen Journalismus zeigt, wie wir ihn gerne hochleben lassen – wie er aber nur noch in den seltensten Fällen funktioniert. Nicht, weil die Grundsätze des Journalismus heute andere wären. Aber die Umstände. Schon Spotlight (der sich mit Die Verlegerin einen Drehbuchautoren teilt: Josh Singer) war nicht frei von verklärerischen Anflügen, porträtierte er doch einen idealtypischen Journalismus.
Ein Recherche-Squad des Boston Globe verbarrikadiert sich monatelang im Keller, wühlt Akten und zieht Querverbindungen – frei von redaktionellen Sorgen, protegiert von einem Chefredakteur, der mit wirtschaftlichen Vorgaben seinen Dienst antritt, im entscheidenden Moment aber das publizistische Interesse über das ökonomische stellt. Der feuchte Traum eines jeden investigativen Rechercheurs. Dass er ab und an mal gelebt wird, macht ihn nicht zur Regel. Spielberg setzt noch einen drauf: Am Ende des Films schlendern Die Verlegerin Katharine Graham und Chefredakteur Ben Bradlee einmütig aus dem Druckhaus dem Sonnenuntergang entgegen. Ein bisschen so, als seien publizistische und ökonomische Interessen Ying-und-Yang-mäßig in Einklang gebracht.
Glattpolierte Fingerübung Spielbergs
Das klingt jetzt alles furchtbar negativ. Nochmal: Die Verlegerin ist beileibe kein schlechter Film. Wer sich für die Zeit, die Themen und (Medien-)Geschichte interessiert, der wird sich mit Spielbergs neuestem Werk anfreunden können. Doch so sehr ich es auch als Journalistenfilm in meine Arme schließen will, weil es die Bedeutung einer Errungenschaft namens „Pressefreiheit“ unterstreicht, ist mir Die Verlegerin zu glatt, zu poliert. In meinen Augen nicht der Instant-Genre-Klassiker, den manche in ihm sehen wollen. Sondern irgendwo angesiedelt zwischen längst überfälligem Prequel (Danke, Herr Busche) und redundantem Remake.
Hörtipp
In your face, Donald Trump. Podcast der “üblichen Verdächtigen” auf schönerdenken.de.

COMMENTS